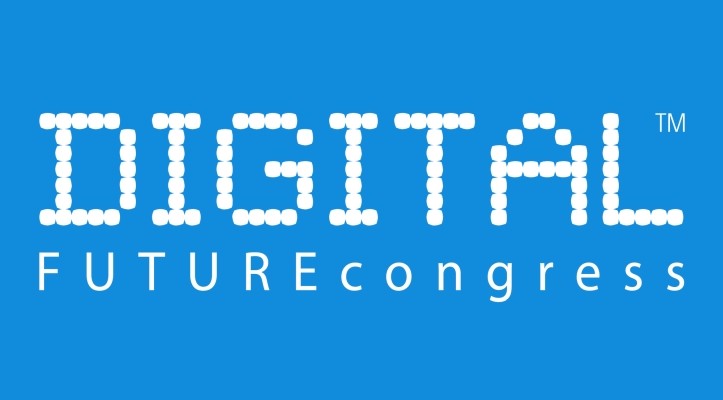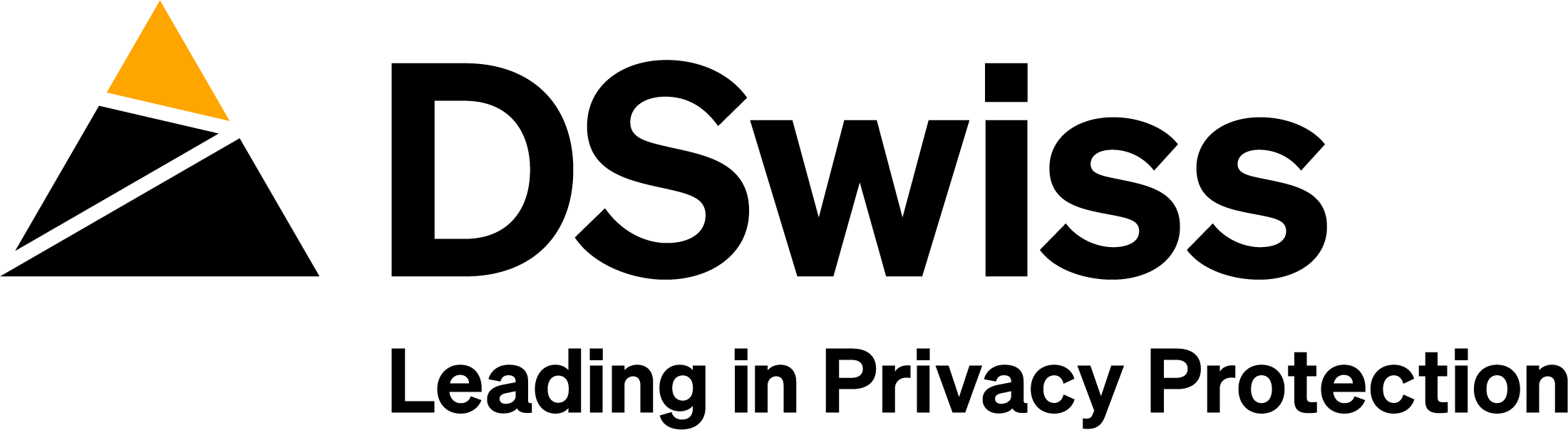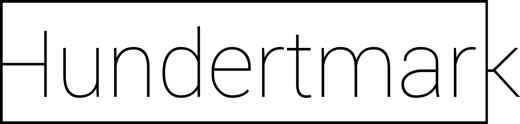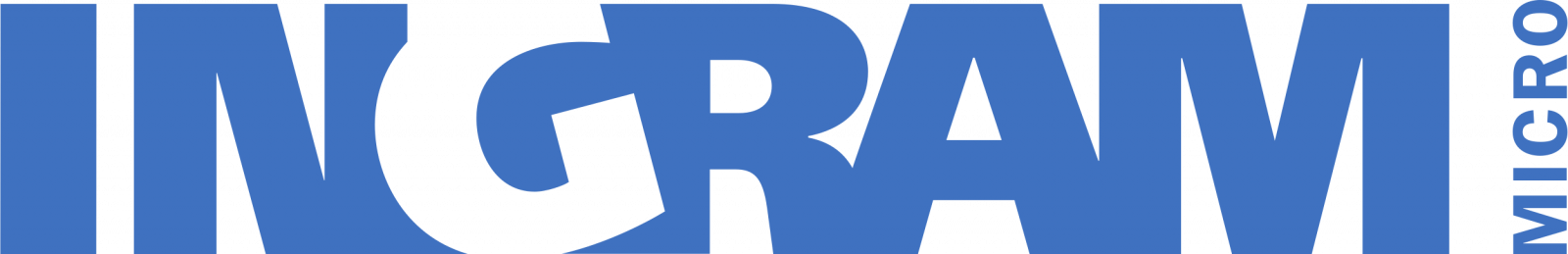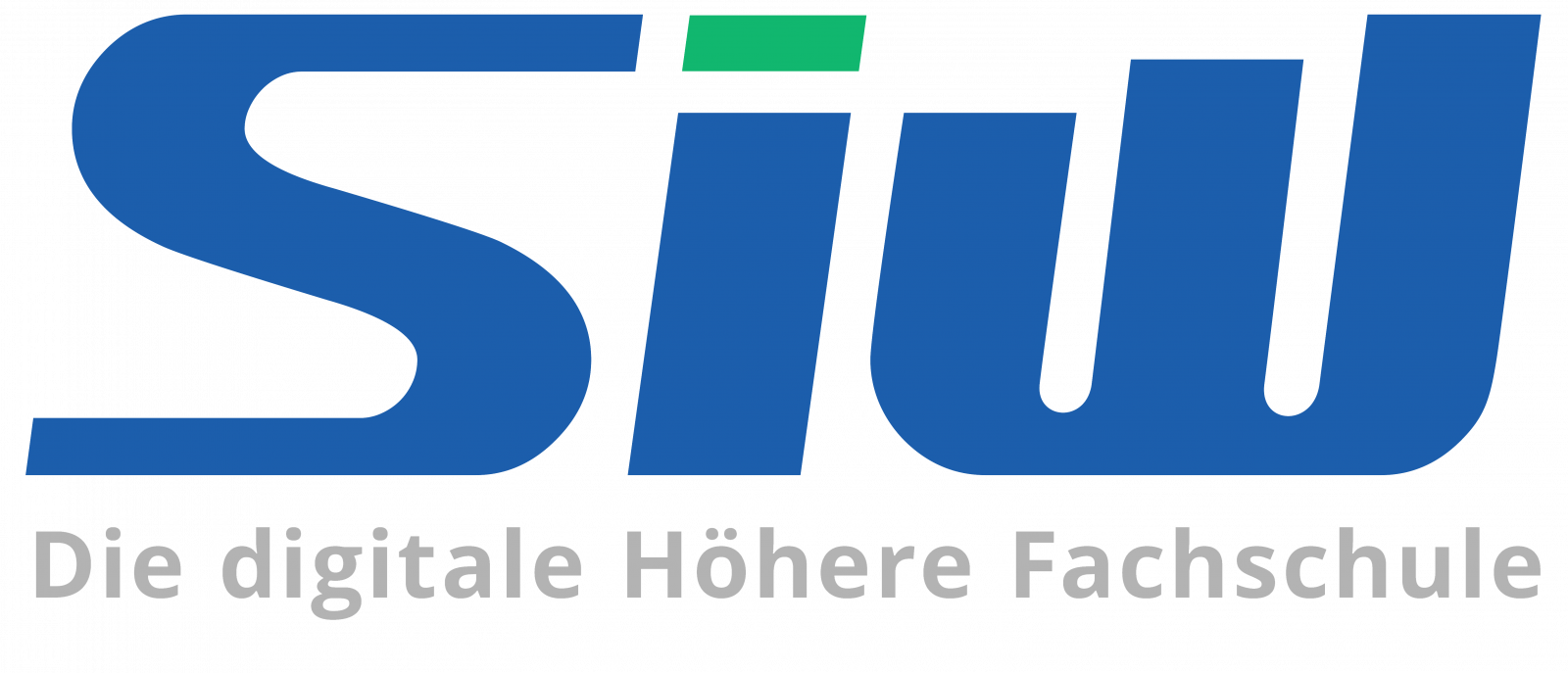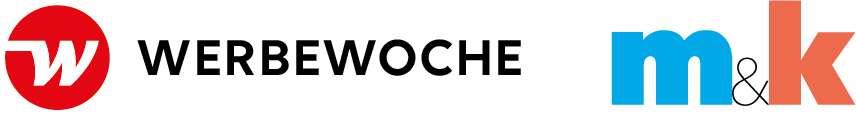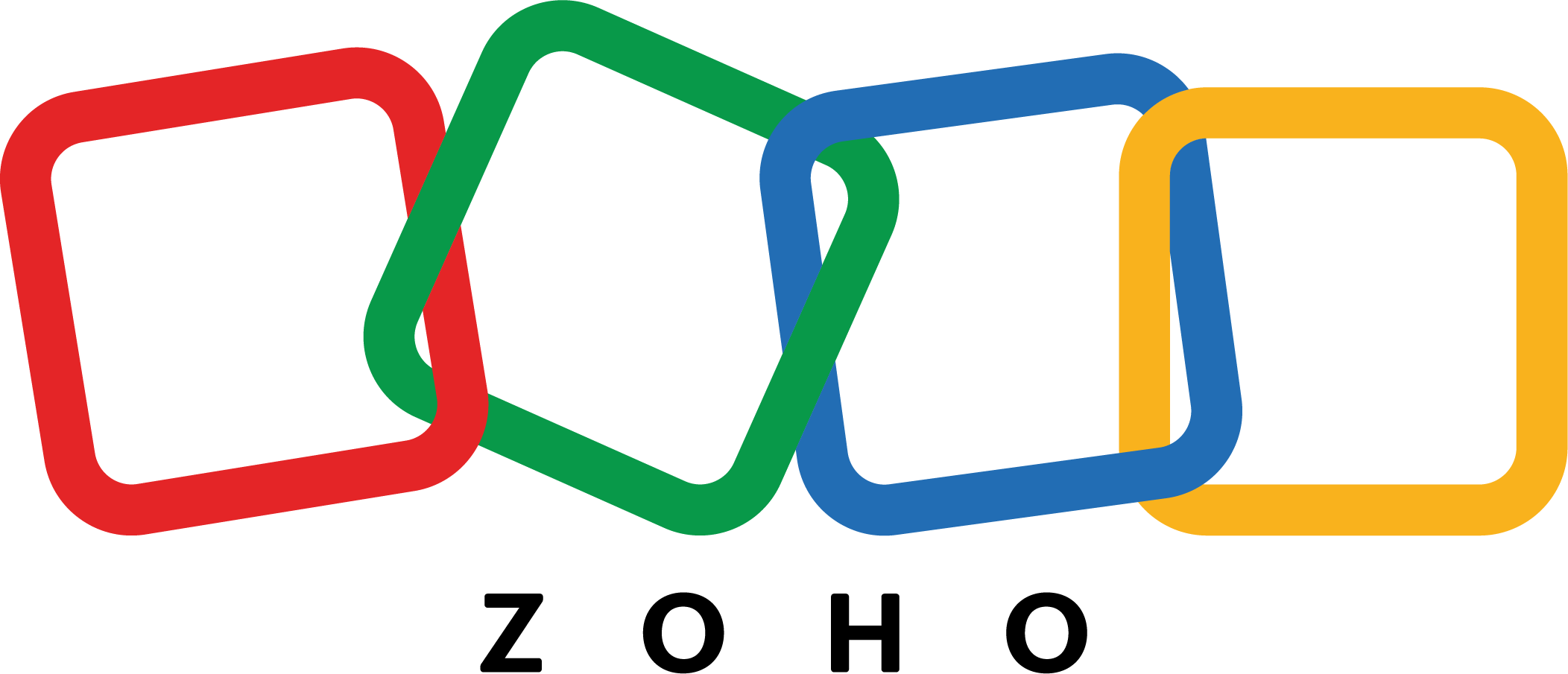«Ohne Vertrauen geht es nicht»
Die personalisierte Medizin wirft Fragen hinsichtlich des Datenschutzes auf. Wie die Systeme im Gesundheitssystem zukünftig gebaut und gehärtet werden müssen, erklärt Effy Vayena, Professorin für Bioethik an der ETH Zürich.
Von Fabio Bergamin, ETH-News und Magazin Globe
Warum in der personalisierten Medizin ein sorgfältiger, fairer und transparenter Umgang mit persönlichen Daten essenziell ist, erklärt Effy Vayena, Professorin für Bioethik am Institut für Translationale Medizin der ETH Zürich. Sie befasst sich dort mit ethischen, juristischen und gesellschaftlichen Fragen der personalisierten Medizin.
Die Schweiz möchte in den nächsten vier Jahren eine nationale Dateninfrastruktur für die personalisierte Medizin aufbauen. Sind wir dafür bereit?
Effy Vayena: Ich würde sagen, wir bereiten uns darauf vor. In dieser Phase müssen wir Systeme aufbauen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten von Patienten und Gesunden ermöglichen. Dabei müssen technologische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen diskutiert werden.
Wie erleben Sie die öffentliche Debatte zu diesen Fragen?
Vayena: Ich nehme in der Öffentlichkeit den neuen Technologien gegenüber eine grosse Begeisterung wahr. Die Leute beschäftigen sich aber auch stark mit Bedenken und Ängsten, wobei manchmal Dinge, die nicht direkt etwas miteinander zu tun haben, verschmolzen werden. Viele Bürger fürchten sich im Allgemeinen vor einer exzessiven Überwachung, was durchaus berechtigt ist, und sie missbilligen eine intransparente Verwendung von persönlichen Daten durch Internetfirmen. Dabei geht häufig vergessen, dass in der Medizin sehr viel Sorgfalt auf Datenschutzvorkehrungen verwendet wird.
Im Januar wurde allerdings bekannt, dass Hacker es schafften, in ein norwegisches Gesundheits-IT-System einzudringen.
Vayena: Ja, die Cyberkriminalität betrifft nicht nur andere personenbezogenen Daten, sondern leider auch Gesundheitsdaten. Umso wichtiger ist eine sichere Dateninfrastruktur. Es werden tatsächlich erhebliche Anstrengungen unternommen, um Gesundheitsdaten vor Missbrauch zu schützen, und der Aufbau einer sicheren Infrastruktur ist auch in der Schweiz eine der wichtigsten Prioritäten. Unsere Institutionen müssen aber auch der Öffentlichkeit aufzeigen, dass sie hohe Standards erfüllen und das öffentliche Vertrauen verdienen.
Wie steht es um dieses Vertrauen?
Vayena:Den Gesundheitsinstitutionen wird vertraut. Wenn Leute ins Spital gehen, fühlen sie sich sicher. Es gibt zwar Studien, die zeigen, dass öffentliche Institutionen weltweit an einem Vertrauensproblem leiden. Allerdings zeigen diese Studien auch, dass Gesundheitsinstitutionen eher vertraut wird als anderen. Wir alle, Forschende und Institutionen, haben ein Interesse daran, dieses Vertrauen zu erhalten. Ohne Vertrauen geht es nicht.
Wie kann man dieses Vertrauen erhalten oder gar steigern?
Vayena: Wir müssen sehr achtsam mit den Daten umgehen. Sehr wichtig ist auch, dass in allen Prozessen die Verantwortlichkeiten geklärt sind: Es muss allen klar sein, wer wofür verantwortlich ist, und kein Beteiligter darf sich vor seiner Verantwortung drücken. Und schliesslich müssen wir transparent sein und mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Damit meine ich keine PR-Kommunikation, sondern einen ernsthaften, offenen Dialog. Die Leute müssen verstehen, wozu ihre Daten verwendet werden und warum. Und wir in den Institutionen müssen den Leuten vermehrt zuhören und herausfinden, was ihre Anliegen sind. Die Daten der personalisierten Medizin stammen von Patienten und gesunden Bürgern, und viele der Aktivitäten sind mit Steuergeldern finanziert. Es ist eine Form von Respekt, wenn wir uns auf eine Diskussion mit den Bürgern einlassen.
In der Regel liegen die Daten bei den Spitälern. Verwenden möchten diese Daten jedoch auch spitalexterne Forscher. Das heisst, Daten müssen weitergegeben werden. Unter welchen Bedingungen soll das geschehen?
Vayena: Wer Daten weitergibt, muss sicherstellen, dass der Empfänger eine Reihe von Bedingungen erfüllt, zum Beispiel was den Datenschutz und die Datensicherheit angeht. Wichtig ist auch, dass ein guter und fairer Verwendungszweck vorhanden ist, der einen gewissen Nutzen bringt. Und natürlich können Daten nur weitergegeben werden, wenn die Person, von der die Daten stammen, zuvor einer Weitergabe grundsätzlich zugestimmt hat.
In England sorgte für Aufregung, dass der Nationale Gesundheitsdienst NHS Patientendaten an Google Deep Mind weitergab. Das war nicht vertrauensfördernd.
Vayena: Diese Datentransaktionen waren offenbar nicht gut durchdacht und sind definitiv ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Die Bürger hatten den Eindruck, dass ihre Privatsphäre verletzt worden ist. Wenn eine öffentliche Institution einer privaten den Zugang zu Daten gewährt, gibt es dafür vielleicht einen guten Grund. Dieser muss jedoch bekannt sein, und es muss transparent sein, wer aus der Datenweitergabe welchen Nutzen zieht. Die Geschichten in England haben einen negativen Effekt: Auch wir in der Schweiz sind besorgt, obschon unsere Spitäler nicht darin verstrickt sind.
Dem Recht auf Privatsphäre steht auch das gesellschaftliche Interesse gegenüber, mit Hilfe von Daten Krankheiten zu besiegen. Wird es einmal eine moralische Pflicht geben, dass wir unsere Gesundheitsdaten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
Vayena: Eine einseitige Pflicht kann es nicht geben. Wenn wir über eine individuelle Pflicht sprechen, Daten zur Verfügung zu stellen, muss es auf institutioneller Ebene auch eine Pflicht geben, die individuellen Rechte und Interessen zu respektieren. Ich wäre daher vorsichtig, eine bedingungslose moralische Pflicht zur Weitergabe persönlicher Daten zu postulieren. In bestimmten Bereichen könnte es allerdings tatsächlich zum Vorteil der Gesellschaft sein, wenn wir einen Teil unserer Privatsphäre aufgeben. Voraussetzung ist jedoch, dass es einen gesellschaftlichen Nutzen gibt, der gerecht auf alle verteilt ist und der auch diejenigen erreicht, die in erster Linie ihren Beitrag geleistet haben. Manche schlagen sogar vor, dass wir einen Gesellschaftsvertrag aushandeln könnten, ähnlich wie wir ihn bei den Steuern kennen: Jeder leistet einen Beitrag zum Gemeinwohl, das uns allen zugutekommt.
Die personalisierte Medizin wird unsere Gesellschaft verändern. Auch die Grenzen zwischen gesund und krank könnten sich verschieben. Ist eine Person mit einem Genmerkmal, das ein Krebsrisiko erhöht, gesund oder krank?
Vayena: Diese Frage gibt Anlass zu Diskussionen. Kürzlich nahm ich an einer Veranstaltung mit dem Titel teil: «Sind wir alle krank?» Ich glaube nicht, dass uns die personalisierte Medizin an diesen Punkt bringen wird. Wir sind jedoch dabei, besser zu verstehen, warum wir krank werden. Dies könnte in der Folge dazu führen, dass sich unser Konzept von Gesundheit und Krankheit verändern wird, dass wir Krankheit in Zukunft eher als einen fortschreitenden Prozess auffassen werden.
Worauf müssen wir besonders achten, damit die personalisierte Medizin in den nächsten Jahren zu einem erfolgreichen Projekt wird?
Vayena: Zwei entscheidende Punkte: Erstens gibt es viele Datenbanken mit Gesundheitsdaten. Wenn wir diese für die Forschung öffnen, können wir daraus grossen Nutzen ziehen. Wir können neues Wissen schaffen, das die Lebensqualität Einzelner und das Gesundheitswesen als Ganzes verbessert. Bei einer solchen Öffnung müssen wir jedoch vorsichtig vorgehen und den ethischen Ansprüchen grosse Aufmerksamkeit schenken. Zweitens: Wenn wir das neue Wissen geschaffen haben, müssen wir auch darauf achten, dass sich die Medizin damit nicht in eine Richtung entwickelt, die volkswirtschaftlich nicht nachhaltig ist. Wenn das neue Wissen den Leuten und der Gesellschaft zugute kommt, wird dies das Vertrauen in die personalisierte Medizin stärken. Es braucht allerdings wenig, und das Vertrauen der Leute ist verspielt. Dann ist es schwer, es zurückzugewinnen. Meine Aufgabe als Bioethikerin ist es, solche Fragen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch anzugehen. Basierend auf meiner Forschung formuliere ich auch Empfehlungen zuhanden der Politik und der beteiligten Akteure, in der Schweiz und international.
Quelle: computerworld.ch